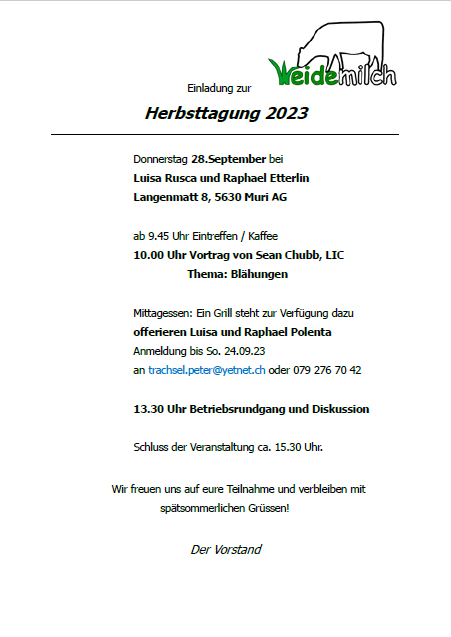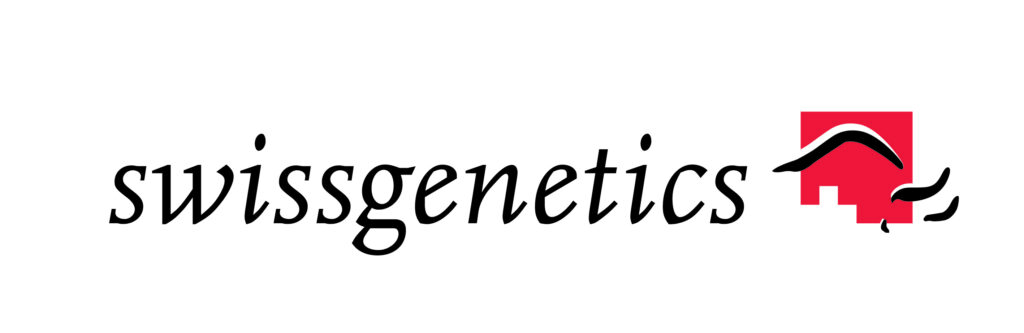Am vergangenen Donnerstag trafen sich die Mitglieder der IG Weidemilch und interessierte Praktiker auf dem Betrieb von Raphael Etteriln und Luisa Rusca oberhalb von Muri im Kanton Aargau zur Herbsttagung.
Kaum einem Milchbauern mit hohem Weideanteil wurde noch nie mit diesem Problem das vor allem im Frühjahr und Herbst auftritt, konfrontiert. Entsprechen gross war das Interesse an der Veranstaltung.
Den Start machte Sean Chupp, Weideberater von LIC Europe, mit einem Videovortrag.
LIC ist eine neuseeländische landwirtschaftliche Genossenschaft sich neben dem Vertrieb von Weidegenetik auch zur Verbesserung der Produktivität einsetzt. So hörten wir das kleereiche, schnell gewachsene (z.B. bei Regen nach einer Trockenheitsphase) Bestände am gefährlichsten im Bezug auf eine schaumige Blähung sind. Es wurden verschiedene Massnahmen und Forschungsergebnisse aufgezeigt wie präventiv das Risiko gemindert werden kann:
Keine hungrigen Kühe auf «gefährliche» Weidekoppeln lassen
Kühe gut beobachten
Altere Bestände weiden
Mehrmals täglich kleine Portionen geben und die Tiere die ganze Pflanze fressen lassen
Zufütterung von 2-3 kg Heu oder Silage
Mischungen im Grasbestand verändern mit Einsaat von Tannin haltigen Pflanzen (z.B. Chicoree)
Mit zur Blähung neigenden Kühen nicht weiterzüchten
Professionell übersetzt aus dem englischen wurde der Vortrag vom Vorstandsmitglied Ana Burger.
Nach einer Diskussionsrunde wurden Fragen direkt vom live zugeschalteten Weideberater beantwortet.
Der zweite Teil bestand aus einem Workshop der anwesenden Landwirte, geleitet von Weidefachmann Remo Petermann vom BBZN Schüpfheim. Auf Flipcharts Wänden trugen die Milchviehhalter ihre eigenen Erfahrungen zu den Faktoren Prävention, Pflanzenbestand, Zufütterung, Düngung, Jahreszeit und Genetik ein.
In der Zusammenfassung und Diskussion untereinander ergab sich ein gutes Abbild der momentanen Situation auf den Weidebetrieben und wo noch Verbesserungen möglich sind. Eine Arbeitsgruppe der IG Weidemilch wird sich in Zukunft dem Thema Blähen widmen. Alle Anwesenden waren sich einig, dass ein in der Schweiz zugelassenes Blähmittel den Landwirten zur Verfügung stehen sollte. Dies würde entscheidend zur Entschärfung des Problems beitragen.
Gestärkt vom selber mitgebrachten Picknick und der von der Familie Etterlin-Rusca offerierten Polenta ging es nach dem Mittagessen auf den Betriebsrundgang.
Raphael Etterlin und Luisa Rusca bewirtschaften zusammen mit zwei Lernenden den Betrieb Langenmatt mit 46 ha Nutzfläche.
Neben 200 Schweinemastplätzen und etwas Ackerbau bildet die Milchproduktion mit 74 Milchkühen den Hauptbetriebszweig. Die Milchkühe und Rinder kalben saisonal im Frühjahr und fressen während der Vegetationsperiode ausschliesslich Weidegras. Der Vollweidebetrieb setzt beim Weidesystem auf Umtriebs Weide mit über 30 Koppeln. Die Herde ist bunt gemischt, es werden Tiere der Rassen Kiwicross, Swiss Fleckvieh, Red Holstein, Holstein, Norwegisch Rotbunt, Jersey und Kreuzungstiere gehalten.
Durch die Ausdehnung der Weidefläche mit Kunstwiesen und somit einem höheren Kleeanteil kam es ab 2022 zu Problemen mit geblähten Kühen und Rindern. Neben dem guten Beobachten in heiklen Phasen, wird auf dem Betrieb Etterlin / Rusca dem Blähen mit folgender Massnahme entgegengewirkt:
Die Tiere beweiden nicht nur eine Tages- und Nachtkoppel, sondern der Tagesbedarf an Weidegras wird in 3 Portionen verabreicht. Damit der Arbeitsaufwand nicht ansteigt geschieht der Wechsel in die nächste Koppel automatisch. Zeitgesteuert, löst sich die Zaunlitze die zur Unterteilung der einzelnen Portionen gespannt wird und sie fällt zu Boden. Die Weidegewohnten Tiere bewegen sich in das frische Gras der neuen Koppel und beginnen zu fressen.
So wird verhindert das die Kühe in den ersten Stunden nicht nur feine Blätter fressen, sondern die ganze Pflanze.
Herzlichen dank Raphael Etterlin und Luisa Rusca für den Einblick in ihren Betrieb und die grosse Gastfreundschaft.
IG Weidemilch
Peter Trachsel